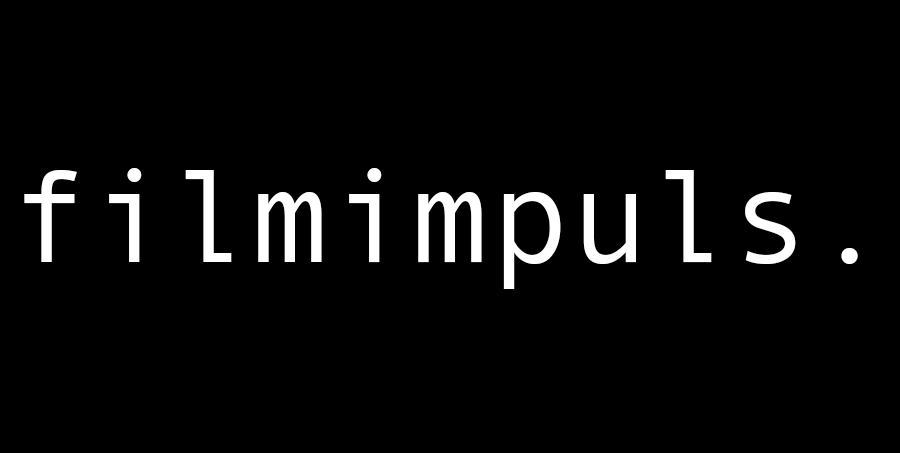Mittelmeermetropole Barcelona: Zwischen Lebensraum und Massentourismus
Filmwissenschaftliche Überlegungen zum Film „City for Sale“ von Lydia Frost
CITY FOR SALE
Katalonien | Spanien | 2018 | Regie: Laura Alvarez | 82 Min | Dokumentarfilm
Wohin soll der
nächste Sommerurlaub gehen? Vielleicht auf eine griechische Insel? Ein
Städtetrip nach Venedig? Oder doch lieber eine Kreuzfahrt entlang der Adria?
Das Mittelmeer ist und bleibt eines der begehrtesten Reiseziele für Touristenströme
aus aller Welt. Eine Studie des Deutschen Tourismusverbands zum Reiseverhalten
der Deutschen im Jahr 2018 legt offen, dass die Liste der beliebtesten
ausländischen Urlaubziele von Spanien, Italien und der Türkei – also alles
Länder des Mittelmeerraums – angeführt wird.[1]
Auch der katalanische Dokumentarfilm City for Sale (2018) der
Regisseurin Laura Alvarez befasst sich mit der Thematik Massentourismus und den
Folgen, die dieser auf die Bewohner der Stadt Barcelona hat.[2] Für
das Jahr 2018 verzeichnet Barcelona rund 16 Millionen Besucher bei einer
Einwohnerzahl von 1,6 Millionen – das sind fast doppelt so viele wie noch im
Jahr 2010.[3] Bei City
for Sale, der auf dem Festival de Málaga und dem DocsBarcelona zum ersten
Mal gezeigt wurde – und nun auch als Deutschlandpremiere im Rahmen der 12.
Mittelmeer-Filmtage läuft – handelt es sich um Laura Alvarez‘ ersten
Dokumentarfilm in Spielfilmlänge.[4] Zwei
Jahre lang begleitet die Regisseurin dafür vier Familien aus Barcelona – Montse
und Joan, Mai und Pepi, Carolina sowie Jordi – und zeigt auf, mit welchen Problemen
die Bewohner der Touristenmetropole zu kämpfen haben:[5] Die
Zweckentfremdung von Wohnungen, die Vertreibung aus dem eigenen Zuhause,
gesundheitliche Schäden, Depressionen und unzumutbare Lebensumstände sind nur
einige der schwerwiegenden Konsequenzen.
In den folgenden Ausführungen sollen drei Thesen zum Film City for
Sale dargelegt werden. In diesem Zuge sollen außerdem die Geschichte des
Massentourismus sowie Techniken des (Dokumentar-)Films näher beleuchtet werden.
Filme nutzen verschiedene Strategien, um ihre Zuschauer zu beeinflussen
und um eine Wirkung zu erzielen. Die – teils genreabhängigen – Bauformen des
Films lassen sich in „filmanalytisch ergiebige Kategorien“[6], wie beispielsweise
Einstellungsgrößen, Musik und Kameraführung, unterteilen und sind oft
unumgänglich für eine tiefgreifende Analyse der Filmessenz. An dieser Stelle
lässt sich die erste Beobachtung – und damit die erste These – zum Film formulieren:
Durch den Einsatz spezifischer Erzähltechniken des Dokumentarfilms gelingt es City
for Sale, dem Zuschauer die Problematik Massentourismus näherzubringen.
Bevor jedoch auf die konkreten technischen und stilistischen Gestaltungsmittel
des Films eingegangen wird, soll zunächst ein historischer Blick auf das
Phänomen Massentourismus geworfen werden.
Die Expansion des Massentourismus, wie sie heute zu beobachten ist,
beginnt bereits in den 1970er Jahren.[7]
Einkommenssteigerungen, technische Fortschritte im Flugverkehr, die Entwicklung
einer professionellen Tourismusbranche, aber vor allem die Erfindung der
Pauschalreise tragen zu einer Steigerung der jährlichen Urlaubsreisen bei.
Während vor 1970 noch Österreich und Italien zu den beliebten Reisezielen der Westdeutschen
zählen, ermöglicht es die schnellere und immer günstiger werdende Anreise mit
dem Flugzeug nun, auch weiter entfernte Länder wie Spanien problemlos zu erreichen.
Vielseitige Angebote der Reiseveranstalter, wie z.B. voll-organisierte Tagesausflüge,
ziehen immer mehr Besucher an.
Seit 1990 hat sich die Zahl der Touristen in der katalanischen Hauptstadt
Barcelona verzehnfacht.[8] Insbesondere
der Kreuzfahrten-Boom, die Förderung des Massentourismus durch inländische
Tourismusindustrien und der daraus resultierende Wettbewerb zwischen den
Anrainerstaaten des Mittelmeers sind für die steigenden Besucherzahlen
verantwortlich.[9] Dabei zerstören Touristifikation
und Gentrifizierung den Lebensraum der einheimischen Bewohner.
Auf die sozialen Probleme der Anwohner als Folge des Massentourismus
möchte Laura Alvarez mit ihrem Dokumentarfilm City for Sale aufmerksam
machen. Dabei können bestimmte Erzähltechniken maßgeblich dazu beitragen, die
Problematik zu visualisieren und das Publikum zu sensibilisieren.
Eines der zentralen Stilprinzipien in City for Sale ist der
Einsatz von Groß- und Nahaufnahmen der Protagonisten. Die Einstellungsgrößen
verringern die Distanz zwischen Beobachter und beobachtetem Subjekt und
generieren so ein Gefühl der Nähe zu den Menschen und ihren persönlichen
Schicksalen. Neben den Einstellungsgrößen spielt auch der formale Aufbau des
Bildes eine wichtige Rolle. Häufig sind die Protagonisten im Bildzentrum
positioniert, wodurch die Aufmerksamkeit des Rezipienten unmittelbar auf die Betroffenen
gelenkt wird. Überdies zeigt die Kamera die Akteure mehrfach von hinten und
begleitet sie so durch das Geschehen. Der Zuschauer wird in die Rolle des
Begleiters hineinversetzt und dazu aufgefordert, die Geschichten der Einwohner Barcelonas
zu verfolgen. Außerdem erlaubt die Positionierung der Kamera, die Auswirkungen
des Massentourismus aus den Augen der Leidtragenden zu erleben. Mitunter dient
auch die Kameraführung der Vermittlung der Thematik. Der vermehrte Einsatz der
Handkamera, welche sich durch leichte Bewegungen des Bildes auszeichnet,
erzeugt ein ‚Realitätsgefühl‘ und unterstreicht damit die Tatsächlichkeit und
Dringlichkeit der Problematik.
Ein weiteres Mittel, dessen sich der Film bedient, ist die Montage.
Beispielhaft lässt sich hierzu eine Szene anführen, in der Jordi in einem
Touristenbus sitzt. Die Montage kurzer Einstellungen, die Jordi aus
unterschiedlichen Perspektiven zeigt, trägt zur Charakterisierung des
Protagonisten bei. Das die Montage begleitende Voice-Over, in dem Jordi über
die negativen Konsequenzen des Tourismus und mangelnde Lösungsansätze seitens
der Regierung spricht, bekräftigt eine Sympathielenkung, wobei Empathie und
Mitleid für Jordi und seine Situation geweckt werden.
Doch City for Sale operiert nicht nur auf visueller Ebene, auch die
Ebene des Auditiven ist bedeutungsgenerierend. Die weitgehend unveränderten
Dialoge zwischen den dargestellten Personen, welche auch alltägliche
Belanglosigkeiten enthalten, tragen zum Realitätseindruck des Geschehens bei.
Anders als beim fiktionalen Film zeigt der Dokumentarfilm dem Betrachter unvorbereitete
Gespräche und reale Konversationen. Zuletzt fungiert auf der auditiven Ebene
die in City for Sale minimal gehaltene musikalische Untermalung. Da der
Dokumentarfilm ohne eine Erzählerstimme auskommt und stimmlich nur über die
Dialoge und Aussagen der Protagonisten erzählt, wird die Musik in Momenten des
Schweigens zu einem wesentlichen Stilmittel. Die ruhige, unterschwellige Hintergrundmusik
wird dabei vor allem während Montagen eingesetzt. Häufig verzichtet der Film
aber auch ganz auf einen musikalischen Rahmen, wodurch die visuelle Darstellung
der Thematik in den Mittelpunkt gerückt wird.
Nicht nur die Bewohner Barcelonas, sondern auch die Stadt selbst ist von
der Touristifikation betroffen. Hier soll die zweite These der vorliegenden
Ausführungen ihren Ausgang nehmen: Die Stadt
Barcelona fungiert als weiterer eigenständiger Hauptakteur in City
for Sale.
Erneut tragen spezifische Bauformen des Dokumentarfilms, wie etwa die
Einstellungslängen, zur Charakterisierung der Stadt als Protagonist bei. City
for Sale konfrontiert das Publikum wiederholt mit verhältnismäßig langen
Einstellungen, wenn ihm Stadtbilder mit Menschenmengen und belebten Straßen
gezeigt werden. Auch die establishing shots einzelner Szenen zur
Festlegung des Handlungsorts lassen die Erschließung des Raumes ‚Barcelona als
Lebensraum‘ zu.
Konträr zu den bereits erwähnten Groß- und Nahaufnahmen der Protagonisten
stehen zudem viele Totalen, welche dem Zuschauer einen Einblick in das
städtische Treiben der Mittelmeermetropole geben. Die Relevanz, welche den
Kameraeinstellungen und -bewegungen hier zugeschrieben wird, etabliert die
Stadt Barcelona als eigentlichen Hauptakteur des Films. Nicht minder bedeutsam
ist hierbei der Filmtitel, für den die Großstadt die namensgebende Funktion
erfüllt.
Die naturalistische und überwiegend unverfälschte Geräuschkulisse
unterstreicht diese Wirkung: Baulärm, Straßengeräusche, das Läuten von
Kirchenglocken, die Gespräche der Touristen, die Rufe der Protestanten, das
Trommeln des Regens – sie alle stellen charakteristisch das Alltagsleben in
Barcelona dar.
Der Mittelmeerraum besitzt einen ambivalenten Charakter. Auf der einen
Seite symbolisiert er den Lebensraum der dort ansässigen Menschen, die schon
ihr ganzes Leben am Mittelmeer verbracht haben. Auf der anderen Seite ist er
zum überaus populären Reiseziel unzähliger Urlauber geworden. Vor diesem
Hintergrund soll nun die dritte und letzte These zum Film aufgestellt werden: City
for Sale bildet ebendiese Ambiguität des Mittelmeerraums als Lebensraum
einerseits und als Urlaubsziel andererseits am Beispiel der Stadt Barcelona ab.
Ambiguität, also Zweideutigkeit, entsteht häufig dort, wo zwei Perspektiven
aufeinandertreffen. Auch das Mittelmeer vereint zwei Perspektiven, die David Abulafia
treffend als „Zusammenprall der Kulturen“[10]
beschreibt: die Perspektive der Einheimischen, die das Mittelmeer als ihren Wohn-
und Lebensraum wahrnehmen und die der Touristen, die das Mittelmeer als Urlaubsziel
und Ort der Entspannung empfinden. Exemplarisch präsentiert City for Sale
diese Ambivalenz beispielsweise, als Montse sich mit ihrem Rollwagen durch
fotografierenden Touristenmassen drängen muss, um ihren täglichen Einkauf auf
dem Markt zu erledigen.
Der Massentourismus ist für die Anrainerstaaten des Mittelmeers eine
bedeutende Einnahmequelle, weswegen die Tourismusindustrie in vielen Ländern
Maßnahmen zur Förderung dieses Wirtschaftszweiges ergreift. Damit einher gehen in
den beliebten Reisezielen häufig Preiserhöhungen und steigende Mieten, von
denen auch die Einheimischen betroffen sind.
Im Zusammenhang mit der Tourismusförderung werden vielerorts neue Jobs
geschaffen. Was zunächst als positive Entwicklung erscheint, wird bei genauerem
Hinsehen aufgelichtet: Die neu entstandenen Jobs durch den Massentourismus sind
meist zeitlich begrenzt und werden extrem schlecht bezahlt.[11]
Ein weiterer Punkt, in dem der ambivalente Charakter des Mittelmeerraums
sichtbar wird, ist die Wohnungssituation in vielen Großstädten. Zur
Unterbringung der Touristenfluten entstehen zahlreiche neue Ferienwohnungen,
Apartments und Hotels. Dazu werden meist schon bestehende Wohnungen umgewandelt
und ihre eigentlichen Bewohner vertrieben. Neue Übernachtungsmöglichkeiten für
die eine Seite bedeuten Wohnungsverluste für die andere Seite. Auch City for
Sale thematisiert die problematische Wohnsituation in Barcelona. Die
Ambiguität der Lage wird am Beispiel des Protagonisten Jordi sichtbar: Der
Wohnkomplex, in dem Jordi bereits sein ganzes Leben lang wohnt, wurde in ein
Hotel umgewandelt. Im Gegensatz zu den anderen Anwohnern des Gebäudes lässt
sich Jordi jedoch nicht vertreiben. Er lebt nach wie vor in seiner Wohnung – umgeben
von nummerierten Hotelzimmern, einer Rezeption im Eingangsbereich und ständig
wechselnden Nachbarn.
Daneben zählt auch die verheerende Umweltbelastung zu den Auswirkungen
des Massentourismus. Kreuzfahrten werden immer beliebter und gelten als
besonders komfortable Form des Reisens für Touristen. Die Folge des Aufschwungs
der Kreuzfahrtreisen ist eine erhebliche Wasser- und Luftverschmutzung, woraus
wiederum – zum Teil schwere – gesundheitliche Beeinträchtigungen der Hafenstadt-Bewohner
resultieren. Während immer mehr Luxus und Komfort auf den Kreuzfahrtschiffen zu
haben ist, kommt es zu einer kontinuierlich sinkenden Lebensqualität der
Einheimischen in ihrem eigenen Zuhause.
Die aktuelle Situation in Barcelona und anderen touristischen
Urlaubszielen der Mittelmeerregion ist für viele Bewohner nicht mehr hinnehmbar.
Was kann also getan werden? In vielen Touristen-Hochburgen haben die Anwohner
schon vor einiger Zeit begonnen, aktiv gegen den Besucheransturm zu
protestieren. So auch in Barcelona: Gegen Ende des Films zeigt City for Sale
Bilder von Protestanten, die mit Rufen und erhobenen Schildern durch die
Innenstadt ziehen. ‚Stop mass
tourism‘, ‚Abolish all tourist apartments‘ und ‚La Barceloneta is a neighborhood,
not a holiday resort‘ steht auf den Plakaten geschrieben.
Auch die Politik fängt an, mit Maßnahmen auf den Massentourismus zu
reagieren. In Barcelona wurde bereits angeordnet, „die Wohnungspolitik, die
Regulierung des Immobiliensektors und Beschränkungen für die Touristikbranche
in den Mittelpunkt der Kommunalpolitik“[12] zu
stellen. So musste beispielsweise das Vermietungsunternehmen Airbnb eine Strafe
in Höhe von 600 000 Euro zahlen, nachdem es sich neuen Bestimmungen zur
Beschränkung der Vermietung von Privatwohnungen entzogen hat.[13]
Doch dies ist bei Weitem noch nicht genug, um dem Leiden der Anwohner ein
Ende zu setzen. Weitere Maßnahmen und eine aktive Einschränkung des Tourismus
sind von Nöten, um eine dauerhafte Lösung zu erzielen. „[W]eg vom
Billig-Party-, hin zum Qualitäts-Bildungs-Tourismus“[14] soll
der neue Weg dabei lauten. Bevor nun also die nächste Reise gebucht wird,
sollten wir alle kurz innehalten und überlegen, wie wir unseren Urlaub
verbringen wollen – der Umwelt und den Einheimischen zuliebe.
[1] Vgl. „Zahlen – Daten –
Fakten 2018,“ Deutscher Tourismusverband
DTV, letzter Zugriff am 27.01.2020,
https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/ZDF_2018_Web.pdf.
[2]
Vgl. Laura Alvarez, City for Sale (Katalonien: Bausan Films, 2018,
Vimeo).
[3] Vgl. „‚Tourist go home‘ – Massentourismus
überrollt Barcelona,“ 13.08.2019, YouTube Video, 02:40, https://www.youtube.com/watch?v=bP3e1bfoOKA.
[4] Vgl. „Laura Alvarez Soler. Documentary
filmmaker & multimedia producer,“ Laura Alvarez Soler, letzter Zugriff am
27.01.2020, https://www.lauraalvarezsoler.com/about.
[5] Vgl. „City for Sale. A documentary film about
the consequences of mass tourism in Barcelona,“ Bausan Films, letzter Zugriff
am 27.01.2020, http://www.cityforsalefilm.com/ENG/ENGdocumental.html.
[6]
Werner Faulstich, Grundkurs Filmanalyse (Paderborn: Wilhelm Fink, 2013),
117.
[7] Vgl. zu diesem Abschnitt
Sina Fabian, „Massentourismus und Individualität. Pauschalurlaube westdeutscher
Reisender in Spanien während der 1970er- und 1980er Jahre,“ Zeithistorische
Forschungen/ Studies in Contemporary History. 13 (2016): 61-85, https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1416.
[8] Vgl. Thomas Urban,
„Barcelona wehrt sich gegen die Touristenflut,“ Süddeutsche Zeitung,
28.02.2017, letzter Zugriff am 27.01.2020, https://www.sueddeutsche.de/reise/spanien-barcelona-wehrt-sich-gegen-die-touristenflut-1.3390503.
[9] Vgl. Alexis Marrant, Mittelmeer in
Gefahr (Frankreich: arte, 2017).
[10] David Abulafia, „Ein
globalisiertes Mittelmeer: 1900-2000,“ in Mittelmeer. Kultur und Geschichte,
hg. von ders. (Stuttgart: Belser, 2003), 309.
[11] Vgl. Till Bartels, „Hass auf
Spanienurlauber – deshalb sind die Einheimischen so wütend,“ stern,
05.08.2017, letzter Zugriff am 27.01.2020,
https://www.stern.de/reise/europa/spanien–der-tourismusboom-schafft-nur-fake-jobs-7566322.html.
[12] Urban, „Barcelona wehrt sich.“
[13] Vgl. Thomas Urban, „Barcelona geht
gegen den Massentourismus an,“ Süddeutsche Zeitung, 13.03.2018, letzter
Zugriff am 27.01.2020, https://www.sueddeutsche.de/reise/spanien-barcelona-geht-gegen-den-massentourismus-an-1.3895599.
[14] Urban, „Barcelona wehrt sich.“
Literatur und Quellen:
Abulafia, David. „Ein globalisiertes Mittelmeer: 1900-2000.“ In Mittelmeer.
Kultur und Geschichte, hg. von ders., 283-312. Stuttgart: Belser, 2003.
Alvarez, Laura, Reg. City for Sale. Katalonien: Bausan Films, 2018, Vimeo,
82 Min.
Bartels, Till. „Hass
auf Spanienurlauber – deshalb sind die Einheimischen so wütend.“ stern, 05.08.2017, letzter Zugriff am
27.01.2020, https://www.stern.de/reise/europa/spanien–der-tourismusboom-schafft-nur-fake-jobs-7566322.html.
„City for Sale. A
documentary film about the consequences of mass tourism in Barcelona,“ Bausan
Films, letzter Zugriff am 27.01.2020, http://www.cityforsalefilm.com/ENG/ENGdocumental.html.
Fabian, Sina. „Massentourismus und Individualität. Pauschalurlaube
westdeutscher Reisender in Spanien während der 1970er- und 1980er Jahre.“ Zeithistorische
Forschungen/ Studies in Contemporary History 13, Nr. 1 (2016): 61-85, https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1416.
Faulstich, Werner. Grundkurs Filmanalyse. 3. aktualisierte
Aufl. Paderborn: Wilhelm Fink, 2013[2002].
„Laura Alvarez Soler. Documentary filmmaker & multimedia
producer,“ Laura Alvarez Soler, letzter Zugriff am 27.01.2020, https://www.lauraalvarezsoler.com/about.
Marrant, Alexis, Reg. Mittelmeer
in Gefahr. Frankreich: arte, 2017, Ges. am 09.07.2019, arte, 95 Min.
„‚Tourist go home‘ – Massentourismus überrollt Barcelona.“
Tagesschau-Bericht von Stefan Schaaf, 13.08.2019, YouTube Video, 05:01, https://www.youtube.com/watch?v=bP3e1bfoOKA.
Urban, Thomas. „Barcelona
wehrt sich gegen die Touristenflut.“ Süddeutsche Zeitung, 28.02.2017, letzter
Zugriff am 27.01.2020,
https://www.sueddeutsche.de/reise/spanien-barcelona-wehrt-sich-gegen-die-touristenflut-1.3390503.
—. „Barcelona geht gegen
den Massentourismus an.“ Süddeutsche Zeitung, 13.03.2018, letzter
Zugriff am 27.01.2020, https://www.sueddeutsche.de/reise/spanien-barcelona-geht-gegen-den-massentourismus-an-1.3895599.
„Zahlen – Daten – Fakten 2018,“ Deutscher Tourismusverband DTV,
letzter Zugriff am 27.01.2020, https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Presse/Presse_PDF/ZDF_2018_Web.pdf.