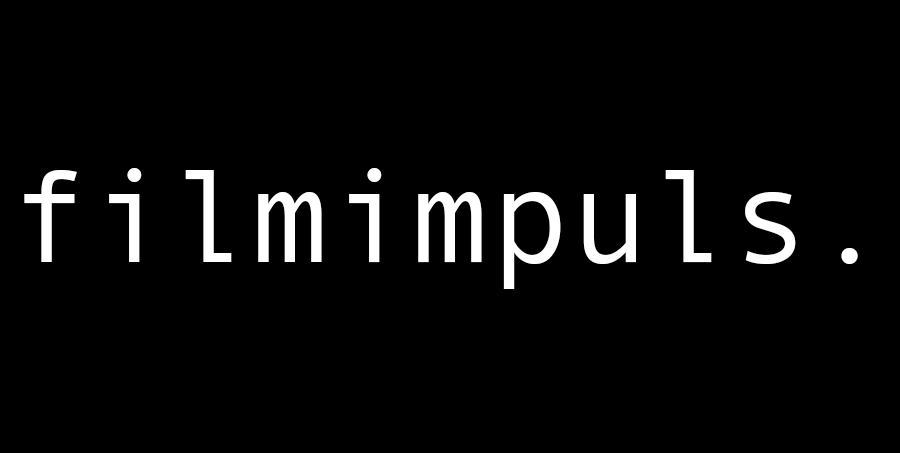Eine Filmeinführung von Ruth Konrad (vorgetragen am 22.01.2020 im Rahmen der Mittelmeer-Filmtage in München)
SELFIE
Italien, Frankreich | 2019 | Regie: Agostino Ferrente | 77. Min | OmeU | Dokumentarfilm
Agostino Ferrentes künstlerischer Dokumentarfilm „Selfie“ gibt einen Einblick in das Leben der beiden 16-Jährigen Pietro und Alessandro. Beide haben die Schule abgebrochen und versuchen jetzt einen Job zu finden. Sie leben in Traiano, einem Bezirk von Neapel. In ihrem Viertel ist der Einfluss der Camorra an allen Ecken und Enden deutlich zu spüren. Dazu kommt, dass der tragische Tod des 16-Jährigen Davide Bifolco im September 2014 deutliche Spuren in den Gemütern der Bewohner des Viertels hinterlassen hat. Der Jugendliche wurde von einem Carabiniere erschossen, offiziell ein Unfall. Die Aufnahmen für den Film entstanden 2017 und sind der Versuch des Regisseurs das Milieu nachzuzeichnen, aus dem der junge Davide stammte. Die beiden jungen Männer, Pietro und Alessandro, sind Davide nicht unähnlich, kannten ihn und sind wie er seinerseits auf der Suche nach einem Platz für sich in einer Welt in der die Zukunft vor allem Gewalt und Kriminalität verspricht. Dabei hat der Titel „Selfie“ eine ganz besondere Bedeutung für die Machart und Wirkung des Films.
Anstatt nämlich, wie in den allermeisten Filmen und auch Dokumentarfilmen üblich, mit einem Kamerateam seine Protagonisten zu begleiten oder in einem Interviewszenario aufzunehmen, hat Ferrente seinen zwei jugendlichen Protagonisten, selbst die Kamera – nämlich ein Smartphone – zur Hand gegeben. So wurden sie selbst zu Regisseuren und haben eine Art Mitspracherecht bekommen, wie ihr eigenes Leben aufgenommen und dokumentiert wird. Wichtig war dem Filmemacher dabei, dass Pietro und Alessandro nicht nur selbst filmen, sondern auch selbst im Bild zu sehen sind. Also ihr Leben selbst aus der Selfie-Perspektive aufnehmen. Im Ergebnis wurde für den fertigen Film, fast ausschließlich diese besondere Kameraeinstellung eingesetzt. Unterbrochen wird diese Perspektive stellenweise nur von Aufnahmen von Überwachungskameras aus dem Viertel, in dem die beiden leben und einigen Aufnahmen von weiteren Jugendlichen der Gegend, die von ihrem Leben erzählen; hier allerdings wird der Selfie-Modus beibehalten.
Das ist für mich als Filmwissenschaftlerin natürlich interessant, dass hier diese besondere Einstellung so dominant eingesetzt wird. Es lässt sich also folgende Fragestellung entwickeln: Warum wurde die Selfie-Perspektive gewählt? Was will der Regisseur damit ausdrücken bzw. welche besondere Wirkung wird durch den Selfie-Modus erzielt?
Dafür kurz ein paar Hintergrundinformation: Der Begriff Selfie ist die Verkürzung des englischen „self-portrait“ und wurde 2002 zum ersten Mal mit seiner heutigen Bedeutung in einem australischen Internetforum verwendet. Infolgedessen breitete sich der Begriff „Selfie“ rasant in der englischsprachigen Welt aus und wurde auch in viele andere Sprachen übernommen, zum Beispiel Deutsch und Italienisch.
Ein Selfie bezeichnet allgemein ein Foto, das von der abgebildeten Person selbst aufgenommen wurde, typischerweise mit einem Smartphone. Charakteristisch für ein Selfie ist außerdem der Blick des oder der Selfiefotograf/-in entweder direkt in die Kamera oder leicht daneben, bzw. darunter, nämlich auf den Smartphone-Bildschirm, in dem der- oder diejenige sich selbst sehen kann und so gegebenenfalls die Pose oder Kamerawinkel nach Belieben nochmals beeinflussen kann. Im Unterschied zu einem normalen Bild, in dem ein Fotograf ein Foto von einem Motiv aufnimmt, sehen wir auf einem Selfie gleich den ganzen Prozess abgebildet. Der Fotograf eines Selfies ist gleichzeitig das Motiv des Selfies. Im Film sind einige solche Momente zu sehen, in denen Pietro und Alessandro gezeigt werden, wie sie sich selbst in der Aufnahme betrachten und dann Kamerawinkel oder Pose nochmal anpassen.
Selfies sind historisch betrachtet ein sehr junges, also zeitgenössisches Phänomen. Seit der Einführung von Frontkameras in Smartphones und insbesondere seit unser soziales Leben immer weiter von virtuellen sozialen Netzwerken durchdrungen wird, ist der Bildtyp Selfie ein beliebtes Mittel der Selbstdarstellung geworden. Auf Instagram zum Beispiel lassen sich unter dem Hashtag #selfie über 410 Millionen Selbstbildnisse finden. Selfies gehören insbesondere für Jugendliche zum Alltag dazu.
Es lässt sich daher eine erste These aufstellen, dass der Regisseur bewusst diese Kameraeinstellung ausgewählt hat, um mit der Selfie-Perspektive moderne Kommunikationsmethoden nachzuempfinden, um den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, sich in einer Weise auszudrücken, die für sie in den sozialen Medien alltäglich ist. Der Selfie-Modus macht Pietro und Alessandro dabei fast schon zu Co-Regisseuren, das wird besonders dann deutlich, wenn sie im Film selbst darüber diskutieren welche Szenen sie zeigen wollen und welche sie vielleicht lieber nicht aufnehmen wollen. Alessandro insbesondere ist es wichtig ein positives Bild von ihrem Leben zu porträtieren. In diesen Szenen wird deutlich, wie wichtig es Ferrente war, Alessandro und Pietro ein gewisses Maß an Kontrolle über ihr eigenes Narrativ zu geben.
Ebenso interessant ist, dass das Selfie zwar eine Erfindung des 21. Jahrhunderts sein mag, jedoch das Selbst-porträt, und nichts anderes ist ein Selfie ja – schließlich ist schon der Name die Verkürzung des englischen self-portrait – blickt auf eine wesentlich längere Tradition in der Kunstgeschichte zurück. Ab der frühen Renaissance in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts können einige Maler/-innen in ihren eigenen Gemälden identifiziert werden, die sich also selbst in ihren Gemälden verewigt haben. Albrecht Dürrer beispielsweise ist bekannt für seine Selbstporträts aus dieser Zeit, später experimentierten beispielsweise auch Vincent Van Gogh, Andy Warhol und Frida Kahlo mit der Form des Selbst-Porträtierens.

Von Albrecht Dürer – Fig 36 from Self Portrait: Renaissance to Contemporary (Anthony Bond, Joanna Woodall, ISBN 978-1855143579)., Gemeinfrei, Link
Der Vergleich eines gemalten Selbstporträts und eines Selfies lenkt den Blick zunächst vor allem auf die Unterschiede. Augenscheinlich gibt es große Differenzen was den Produktionsprozess, das Medium selbst und typische Komposition anbelangt. In der Produktion eines gemalten Selbstporträts steckt beispielsweise ein viel größerer zeitlicher und finanzieller Aufwand. Die Produktion eines Selfies dagegen ist eine Sache von wenigen Sekunden, die bei genügend Speicherplatz auf dem Aufnahmegerät auch quasi beliebig oft wiederholt werden kann. Während Van Gogh beispielsweise in seinem Oeuvre eine erstaunlich große Anzahl von 43 Selbstporträts zählt, kann es gut sein, dass besonders motivierte Selfie-Fotographen/-innen eine so große Anzahl an Selbstbildnissen an einem einzigen Tag schießen. Außerdem, wer selbst schon mal ein Selfie aufgenommen hat, weiß vielleicht, dass es häufig eben gerade nicht bei einem singulärer Schnappschuss bleibt, sondern ein Selfie das Ergebnis vieler in kurzer Abfolge hintereinander aufgenommener Bilder ist, aus denen dann das Attraktivste herausgesucht wird.
Trotzdem lassen sich auch Gemeinsamkeiten finden. Das Selbstporträt in der Malerei bietet sich für die Selbstinszenierung ebenso an wie das Selfie. Wenn auch viel aufwändiger in der Produktion, ist das Selbstporträt für einen oder eine Maler/-in die Gelegenheit sich selbst im besten Licht zu präsentieren oder besondere Ereignisse wie den eigenen Status festzuhalten. Ebenso ist auch das Aufnehmen eines Selfies heutzutage häufig davon motiviert, einen bestimmten Moment, wie etwa eine Urlaubsreise, zu dokumentieren oder eine Errungenschaft, wie beispielsweise den Waschbrettbauch oder den Studienabschluss, festzuhalten.
Obwohl also Selfies viel häufiger und zu viel alltäglicheren Gelegenheiten aufgenommen werden, drücken sich darin trotzdem ähnliche Motivationen wie in den Selbstporträts aus der Malerei aus. Sie sagen etwas über den oder die Schöpfer/-in des Selbstbildnisses aus, aber vermitteln auch etwas über Menschen im Allgemeinen. Es wird deutlich, dass es ein grundlegendes menschliches Verlangen zu geben scheint, einen bestimmten Moment festhalten zu wollen, das eigene Leben, die eigene Persönlichkeit und die äußere Erscheinung dokumentieren zu wollen. Den Wunsch die aktuelle Situation, Stimmung oder Gefühle einzufangen, um so die eigenen Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Insbesondere der direkte Blick des Selbstbildnisses auf den oder die Betrachter/-in lädt zur Empathie ein.
Die Selfie-Perspektive in Ferrentes Film hat mit Blick auf die Tradition des Selbstporträts einen ähnlichen Effekt. Alessandro und Pietro, als Jugendliche aus Neapel, sind es gewohnt in der medialen Berichterstattung auf schwarz-weiß gezeichnete Stereotype reduziert zu werden. Während Gewalt und Kriminalität zwar in ihrem Umfeld stark zu spüren sind, hat das Leben der beiden Jugendlichen doch so viel mehr Schattierungen. Ferrentes Film und insbesondere die Selfie-Einstellung gibt ihnen die Möglichkeit die gängigen Klischees zu überwinden, indem sie selbst die Erzählerposition einnehmen. Wir sehen wie zärtlich die beiden miteinander umgehen können und welche alltäglichen Sorgen sie plagen. Der Film gibt ihnen so eine Plattform und eine selbstbestimmte Ausdrucksweise, die ihnen in den üblichen medialen Strukturen nur selten zugestanden wird.